Liebe Leser:innen,

ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Klimakrise, Artensterben, Plastikverschmutzung, Verlust natürlicher Lebensräume – all das macht entschlossenes Handeln nötig. Den Mut dazu gibt uns die wiederkehrende Erfahrung, dass positive Veränderungen möglich sind.
Der vorliegende Jahresbericht des WWF Deutschland 2023/2024 ist ein Zeugnis sowohl der Dringlichkeit als auch der Kraft des Handelns. Der jüngst erschienene WWF Living Planet Report hat uns abermals ins Bewusstsein gerufen, um was es wirklich geht. Mit weiterem Verlust von Biodiversität und natürlichen Lebensräumen sowie ungebremster Erderwärmung nähern wir uns gefährlichen, womöglich irreversiblen Kipppunkten.
Zugleich erleben wir, dass große internationale Konferenzen mit bestenfalls mageren Ergebnissen mit Mitteln für Natur- und Klimaschutz geizen. Angesichts dieser Rahmenbedingungen setzt der WWF Deutschland alles daran, die begrenzten Ressourcen maximal wirkungsvoll einzusetzen. Hierzu haben wir im Frühjahr 2024 eine strategische Fokussierung und Konsolidierung beschlossen. Damit sorgen wir für Stabilität auch in Zukunft. Mit agiler Struktur und gleichberechtigtem Vorstandsteam schaffen wir die Voraussetzungen, um in einer zunehmend komplexen Welt flexibel zu agieren.
Dabei unterstützt uns jetzt mit Wilfried Gillrath ein neuer Stiftungsratsvorsitzender, der sich mit unternehmerischer Entschlossenheit, Verantwortung und Weitsicht einen Namen gemacht hat. Das alles stimmt uns zuversichtlich, mit innovativen Ansätzen noch wirksamer unseren Auftrag zum Schutz von Natur und Umwelt vorantreiben zu können.
Was wir unter Wirksamkeit verstehen, illustriert der vorliegende Jahresbericht mit einigen eindrucksvollen Beispielen. Etwa die der stabilen Populationen Afrikanischer Elefanten im KAZA-Schutzgebietsnetzwerk als Ergebnis grenzübergreifender Zusammenarbeit. Dass KAZA heute als Rückzugsort für fast die Hälfte aller Afrikanischen Savannenelefanten gilt, zeigt, was möglich ist, wenn Schutzmanagement und lokale Gemeinschaften Hand in Hand arbeiten.
Hoffnungsfroh stimmen auch die Fortschritte bei der Wiederansiedlung des Wisents im Kaukasus. Die Rückkehr dieser imposanten Tiere ist eine richtig große Erfolgsgeschichte im modernen Artenschutz. Sie zeigt, was möglich ist, wenn internationale Zusammenarbeit, wissenschaftliche Expertise und naturschutzfachliches Engagement zusammenfinden.
Diese Projekte und Entwicklungen stehen exemplarisch für die Strategie des WWF, Lebensräume zu erhalten, den Verlust von Biodiversität zu stoppen und den CO₂-Fußabdruck zu verringern. Doch die Realität bleibt herausfordernd. Allein im August 2024 sahen wir uns 38.000 Bränden im Amazonas-Regenwald gegenüber – ein alarmierender Rekord, der die Notwendigkeit unseres Engagements unterstreicht.
Gefährliche Dürreperioden und Konflikte zwischen Mensch und Tier, wie in vielen Schutzgebieten Afrikas, konfrontieren uns mit massiven Problemen. Sie erfordern kreative Lösungen und auch die Bereitschaft, mit den Erfahrungen jahrzehntelanger Naturschutzarbeit gegangene Wege zu verlassen und neue einzuschlagen. Im Berichtsjahr 2023/2024 haben wir nicht nur praktische Schutzprojekte umgesetzt, sondern auch strategische Weichen gestellt.
Mit innovativen Konzepten wie dem Rahmenwerk zum One Planet Business oder zur Circular Economy arbeiten wir an systemischen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Das, was wir damit auf unterschiedliche Weise transformativ bewegen, trifft auf die entschiedene Unterstützung unserer Förderinnen und Förderer. Über 337.000 Menschen haben uns im letzten Jahr begleitet, motiviert und es ermöglicht, unsere Ziele zu erreichen. Ihnen allen gilt unser Riesendank.
Dieser Jahresbericht gibt Einblick in unsere Arbeit. Er will aber auch Mut machen. Er zeigt nämlich, dass jeder Beitrag zählt – sei es durch aktive Unterstützung, durch Veränderungen im eigenen Alltag sowie die Inspiration anderer. Der Einsatz für die gefährdete Natur lohnt! Seien wir uns bewusst: Handeln ist wichtiger denn je. Gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, in der die Erde lebendig bleibt.
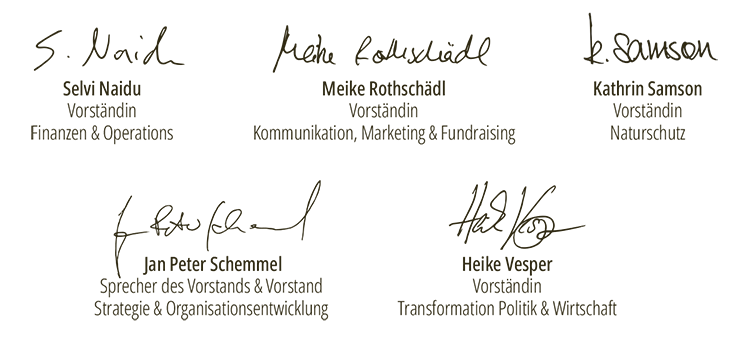
Inhalt
Zahlen & Fakten 2023/2024

1 - Elefanten in Afrika
Jumbos im Sinkflug
Stark, klug, aber verletzlich. Kein anderes Tier verkörpert so charismatisch Afrikas Tierwelt wie die Elefanten. Doch wie geht es ihnen nun nach vielen Jahren, in denen sie als Opfer von Wilderei von sich reden gemacht haben? Die Situation der Afrikanischen Savannenelefanten (Loxodonta africana) muss uns Sorgen machen: Ihr Bestand ist in den vergangenen 50 Jahren um etwa 60 Prozent geschrumpft. Auf der Roten Liste bedrohter Tierarten stehen sie als „stark gefährdet“. Noch unerfreulicher ist die Situation der kleineren Verwandten, der Afrikanischen Waldelefanten (Loxodonta cyclotis), die in den Regenwäldern Zentral- und Westafrikas zu Hause sind. Sie drohen auszusterben. Beide Arten verlieren schlicht an Boden. Ganz im Wortsinn. Tatsächlich sind es oft die schwindenden Lebensräume, die Elefanten verschwinden lassen. Hinzu kommen noch immer Wilderei, Konflikte zwischen Menschen und Elefanten und die Auswirkungen des Klimawandels. Die Problematik ist also komplex. Weil das so ist, arbeitet der WWF mit seinen Partnern an verschiedenen Lösungsstrategien.

- Rückkehr von Wildtieren in Salonga: Die Waldelefanten sind zurück in der Bakalikali Bai, einer Lichtung und Wasserstelle im Salonga-Nationalpark. Lange waren die Wildtiere vertrieben, nun aber ist dieser Teil des Parks sicherer geworden. Dass sich Waldelefanten, Büffel und Leoparden wieder zeigen, ist Beweis für das gute Parkmanagement des WWF und die erfolgreiche Arbeit der Ecoguards in ihrer Anti-Wilderei-Arbeit.
- Strategische Konfliktlösung in der Republik Kongo: Im Ntokou-Pikounda-Nationalpark der Republik Kongo wird das friedliche Zusammenleben zwischen Elefanten und Menschen auf die Probe gestellt. Waldelefanten waren in unbewachte landwirtschaftliche Plantagen eingedrungen und hatten Nahrungsmittelkulturen zerstört. Das führte zu Konflikten zwischen Gemeinden und Tieren, aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Schutzgebietes. Aus dieser Erfahrung heraus hat der WWF ein Pilotprojekt zur Koexistenz zwischen Menschen und Wildtieren (Conflict to Coexistence, C2C) aus der Taufe gehoben.
- Elefanten-Nothilfe im kleinen und großen Maßstab: Dass Elefanten in Wasserlöcher stürzen, kommt vor. Oft sind dann Ranger:innen als Erste zur Stelle und können helfen, wenn sie wissen, wie den Tieren zu helfen ist. 2023 startete der WWF Deutschland eine Kooperation mit der tansanischen KiliCREW (Kilimanjaro Animal Center for Rescue, Education and Wildlife). Ziel dieser Allianz ist es, auch einzelnen, in Not geratenen Elefanten professionell zu helfen, insbesondere in allen vom WWF aufgebauten Schutzgebieten Tansanias. Bei gefährdeten Arten, wie dem Afrikanischen Savannenelefanten, zählt jedes einzelne Leben. 269 Ranger:innen haben im Finanzjahr 2023/2024 diese Ausbildung absolviert. Mittelfristig sollen alle 7.000 Ranger:innen Tansanias entsprechend ausgebildet und mit einer Ersthelfer:innen-Ausrüstung ausgestattet werden.

2 - Wisente
Zurück in die Zukunft
Dieses Mal gingen die drei Männer mit einer Lebendfracht von rund drei Tonnen an Bord. Wieder waren monatelange Vorbereitungen nötig. Und der Job war noch nicht zu Ende, als in der Nacht des 22. Novembers 2023 der Flieger vom alten Militärflughafen im Hunsrück abhob. Jetzt hatten die Männer vom Tierpark und Zoo Berlin sowie vom WWF Deutschland zehn Wisente geladen. Ihr Ziel war erneut der 4.000 Kilometer entfernte Shahdag-Nationalpark an den Südhängen des Großen Kaukasus. Ihre Mission in Fortsetzung: die Wiederansiedlung des größten Landsäugetiers in Europa in seinem alten Lebensraum.
„Die Geschichte des Wisents gilt als eine der hoffnungsvollsten im modernen Artenschutz. Doch noch immer sind Maßnahmen nötig, um die Zukunft dieser Tiere längerfristig zu sichern“, berichtet Christian Kern, Zoologischer Leiter von Zoo und Tierpark Berlin, der die Reise begleitet hat. Neben Christian Kern sorgten Aurel Heidelberg, zuständiger Projektleiter beim WWF Deutschland, und Zoo-Tierarzt Dr. André Schüle dafür, dass es den Tieren während des Transports an nichts fehlte.
Seit 2019 setzt sich der WWF gemeinsam mit dem Tierpark Berlin für die Rückkehr des Wisents in einen seiner natürlichen Lebensräume ein. In freier Wildbahn wurden die letzten Exemplare ihrer Art vor rund 100 Jahren getötet. Auf nur zwölf Gründertiere beruht der gesamte heutige Wisent-Bestand. Entsprechend dünn ist ihr genetischer Pool. Das macht sie anfällig gegenüber Krankheiten.
Alles in allem klingt Dr. Andreas Knieriem, Direktor vom Zoo und Tierpark Berlin, überaus zufrieden, wenn er eine Zwischenbilanz zieht: „Dieses Projekt ist ein inspirierendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn wir Expertise und Engagement bündeln.“ Das hat es möglich gemacht, dass schon 63 Wisente im Nationalpark eine Heimat finden konnten. 50 weitere sollen bis 2028 folgen. Ziel ist es, einen überlebensfähigen Bestand von mindestens 130 erwachsenen Tieren aufzubauen.
„Artenschutzprogramme wie die Wiederansiedlung des Wisents sind komplexe Kraftakte. Sie sind nur durch langfristige Zusammenarbeit von internationalen, nationalen und nicht zuletzt lokalen Partnern zu leisten.“
Aurel Heidelberg, WWF-Referent Ökoregion Kaukasus
Mehr Informationen zu diesem Thema:

3 - Amazonas
Dürren und andere Brandbeschleuniger
Tausendfach loderten die Flammen am Amazonas. Zu groß war die Anzahl der Brände, zu groß und undurchdringlich der tropische Regenwald, als dass ein Alarm genutzt hätte. 2024 war eines der schlimmsten Waldbrandjahre seit Beginn der Aufzeichnungen. 38.000-mal brannte allein im August der Regenwald Brasiliens. Zur selben Zeit standen im größten Feuchtgebiet der Erde, im Pantanal, mehr als eine Million Hektar in Flammen, eine Fläche größer als Zypern. Hier wie dort verschlang das Feuer höchst lebendige Schatzkammern der Artenvielfalt und die Heimat von Menschen.
Und noch ein Extrem: In den vergangenen beiden Jahren war der Amazonas von Dürren bisher unbekannten Ausmaßes betroffen. Der Amazonas-Regenwald nähert sich einem gefährlichen Kipppunkt. Dessen Überschreiten würde ihn in eine Savanne verwandeln, warnt der aktuelle Living Planet Report des WWF. Die Folgen fürs Erdklima wären katastrophal. Das sind alles Gründe, warum wir der Amazonasregion vielfältiges Engagement zuteil werden lassen. Dadurch wurden wir auf ein Drama aufmerksam, das uns zu einer bemerkenswerten Rettungskampagne veranlasst hat

- Auf dem Weg zu den Flussdelfinen: 2024 begleitete der WWF-Südamerika-Experte Dirk Embert ein deutsches TV-Team zu Dreharbeiten ins Amazonasbecken, um das Monitoring der Flussdelfine zu filmen. Eigentlich braucht es große Boote nötig, um sicher zu den Zuflüssen des Amazonas vorzudringen. Doch Boote dieser Art schieden wegen des geringen Wasserpegels aus. So entschied sich der Trupp für Kanus. Aber selbst die mussten oft verlassen und durch Rinnsale geschoben werden, die eine beängstigende Dürre von den Flüssen übrig gelassen hatte. Deren Wasserspiegel war zum Teil auf rund 10 Zentimeter gesunken. An Fische, geschweige denn an Flussdelfine, war in dieser Umgebung nicht zu denken.
- Notfallkampagne und Evakuierung: Schon im Jahr zuvor, 2023, waren an zwei Amazonasseen über 330 Delfine anhaltender Dürre zum Opfer gefallen. Dabei lassen sich nur wenige dieser Gewässer überhaupt beobachten. Unmittelbar nach ersten Hinweisen leitete der WWF Deutschland eine Notfallspendenkampagne ein. Das machte es möglich, dass der WWF Brasilien gemeinsam mit Vor-Ort-Partnern Sofortmaßnahmen zur Rettung der noch lebenden, aber hoch gefährdeten Delfine ergreifen konnte. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten eines staatlichen Instituts machte sich der WWF daran, die geschwächten Tiere aus den Flachwasserzonen in tiefere Gewässer zu manövrieren. Bei der Ursachenermittlung des Massensterbens fielen zwei Besonderheiten auf: die Wassertemperatur von 39 Grad und – auch hier – der niedrige Wasserpegel.
- Brandstiftung als Geschäftsmodell: In aller Regel gehen die Brände im Regenwald auf Brandstiftung zurück. Das sei die „Grundlage für ein Milliardengeschäft“, weiß der Leiter des Lateinamerika-Teams des WWF, Roberto Maldonado. Angesteckt wird häufig das, was Sägen und Bagger zurückgelassen haben. Denn die vernichteten Waldflächen sind einer Bestimmung zugedacht: der von Viehweiden und Ackerland. Einmal in Brand gesetzt, fressen sich die Flammen auf riesigen Flächen voran. Einhergehende Dürre bietet dem Feuer Nahrung und begünstigt dessen Ausbreitung. Wälder, Grasland, Tiere – alles geht in Rauch auf.
- Flächenschutz als Brandschutz: Wie in anderen Bereichen des Lebens erweist sich das Prinzip der Vorbeugung als besonders effektiv. So betreibt der WWF Projekte zum Flächenschutz. Denn ausgewiesene Schutzgebiete wirken wie Bollwerke gegen Waldbrände, besonders dann, wenn sie ein gutes Management vor Entwaldung schützt. Zu deren Stabilität und Dauer verhelfen nachhaltige Finanzierungsmechanismen und unsere Allianzen mit den Menschen, die den Regenwald bewohnen, den lokalen Gemeinden und Indigenen. Wo die Indigenen leben, ist die Biodiversität hoch und die Waldvernichtung gering. Tatkräftig, mutig und beharrlich widersetzen sich die Menschen der indigenen Territorien und Schutzgebiete – wie auf artenreichen Inseln – den Entwaldungsfronten des Amazonas.
„Der Spruch „Die Zeit zu handeln ist jetzt“ erscheint platt und abgenutzt. Aber nicht zu handeln ist keine Alternative angesichts dessen, was gerade im Amazonas geschieht.“
Dr. Dirk Embert, WWF-Programme Officer Südamerika
Mehr Informationen zu diesem Thema:

4 - Mangrovenschutz
Eine starke Verteidigung
Man müsste sie erfinden, wenn es sie nicht schon gäbe: Mangroven. Diese salztoleranten Wälder schützen Küsten vor Stürmen und Fluten. Zudem zählen sie zu den artenreichsten Ökosystemen der Erde, mit positiven Effekten für Einkommen und Ernährung von Küstenanrainern. Kurzum: Ihr Schutz ist essenziell, auch weil sie Menschenleben schützen. Aus dieser Überzeugung heraus hat der WWF 2019 mit einem Projekt zum nachhaltigen Mangrovenmanagement im Indus-Delta Pakistans begonnen, das Natur- und Katastrophenschutz verbindet. Dessen zweite Phase wird 2025 zu Ende gehen. Schon jetzt hat es Beachtliches zuwege gebracht.

Pakistan gehört zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern der Erde. Unvergessen ist die Flutkatastrophe von 2022: Ein Drittel Pakistans stand unter Wasser, 2.000 Menschen verloren ihr Leben, 33 Millionen ihr Hab und Gut. Regelmäßig kommt es zu Klimaextremen. Flussmündungsgebiete sind besonders betroffen, etwa das riesige Indus-Delta im Süden Pakistans. Hier befindet sich das siebtgrößte Mangrovengebiet der Erde. Das ist durch jahrzehntelange Abholzung und Viehweide um rund 40 Prozent geschrumpft und hat entsprechend viel von seiner Küstenschutzfunktion eingebüßt. Zugleich leiden die Küstenbewohner:innen, vor allem während der Trockenzeit, unter extremem Trinkwassermangel.
Diese Situation hat den WWF 2019 veranlasst, ein Projekt zum nachhaltigen Mangrovenmanagement und zur Gemeindeentwicklung zu beginnen. Bisher wurden 3.000 Hektar Mangroven wiederaufgeforstet und weitere 30.000 Hektar durch kommunales Management geschützt. Geblieben ist die Herausforderung extremer Armut. 80 Prozent der Einwohner:innen leben von weniger als zwei US-Dollar pro Tag. Immer weniger Fisch geht in die Netze, seitdem asiatische Fangflotten den Küsten immer näher kommen und die Bestände überfischen. An Land findet das Vieh wegen zunehmender Dürren kaum noch Futter und fällt Fluten zum Opfer. Der nachhaltige Mangrovenschutz soll daher auch den Armutsursachen entgegenwirken. So wurden beim Projekt nicht nur Mangroven gepflanzt, sondern überdies Futtergräser.
Das entlastet die Mangroven vom Beweidungsdruck, hilft der Milchproduktion während der Trockenzeit und verschafft insbesondere den Frauen zusätzliches Einkommen durch den Verkauf des Futters. Zur Entschärfung des Trinkwassermangels wurden Trinkwasserreservoirs angelegt. Daraus können mittlerweile 2.000 Haushalte schöpfen. Zur besseren Einkommenssituation von Frauen hat die Unterstützung von Kleingewerbe beigetragen. Für den Katastrophenschutz wurden Frühwarnsysteme installiert, Lagerräume für die Notfallausrüstung gebaut und Plattformen errichtet, auf die sich besonders alte und krankes Menschen bei Hochwasser flüchten können.
„Über die Mangroven wird trotz ihrer Bedeutung für Biodiversität, Klima- und Küstenschutz weit weniger berichtet als etwa über tropische Regenwälder, Wüsten oder Ozeane. Ich wünsche mir, dass diese einzigartigen Ökosysteme stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.“
Rolf-Dieter Sprung, WWF-Project Manager Sustainable Mangrove Use
Mehr Informationen zu diesem Thema:

5 - Plastik
Stopp dem Ex-und-hopp
So raumgreifend wie das Meer ist auch die Menge an Plastikmüll, die darin schwimmt. Schätzungsweise zwischen 12 und 23 Millionen Tonnen Kunststoffmüll landen jährlich aktuellen Studien zufolge im Meer. Mittlerweile beschäftigen sich die Vereinten Nationen mit dem für die Meeresumwelt potenziell tödlichen Plastik. Eine vom WWF begleitete 4. Verhandlungsrunde zum Thema im kanadischen Ottawa endete Anfang 2024 mit Fortschritten: Ein konkretes Regelwerk zum Stopp weiterer Plastikverschmutzung der Meere sollte bis Ende des Jahres verhandelt werden.
Zugleich steigt die Plastikproduktion weiter an. Darunter sind vor allem Einweg-Produkte problematisch. Ein Zustand, den der WWF nicht hinnehmen will. Wir brauchen dringend eine funktionierende Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen, aber auch allen anderen Materialien. Dazu beauftragt der WWF die Wissenschaft, führt weltweit Projekte für mehr Kreislaufwirtschaft durch, nimmt an hochrangigen Konferenzen teil und schmiedet Allianzen für noch mehr Wirkung.

- Ideen für Mehrweg: 2022 verließen fast 14 Milliarden Speisen und Getränke die Restaurants und Cafés Deutschland – nur 0,7 Prozent davon in Mehrweg-Verpackungen. Seit Anfang 2023 gilt eine Mehrwegangebotspflicht für größere Cafés und Restaurants. Die jedoch macht sich nach Untersuchungen des WWF kaum bemerkbar. Um das zu ändern, hat er gemeinsam mit ProjectTogether und dem Mehrwegverband eine Umsetzungsallianz gegründet. Die heißt mehrweg.einfach.machen.
- Mehrweg beim Halbmarathon und Marathon: Beim Marathon müssen viele Menschen unkompliziert mit Wasser versorgt werden. Viel zu lange wurde nur auf Einweg gesetzt. Aber Mehrweg funktioniert auch dort. Beim Berlin-Marathon 2023 gab es an zwei Stationen Mehrwegbecher. Rund 90.000 Einwegbecher wurden eingespart.
- Mehrweg am Point of Sale: Dort fällt die Entscheidung zwischen Ex-und-hopp und Mehrweg-to-go. 2023 hat die Allianz mit mehr als 800 Filialen verschiedener Gastronomieketten getestet, wie sich die Mehrweg-Quote steigern lässt. Besonders erfolgreich waren Filialen von IKEA: dort wurde die Mehrwegquote auf Filialebene auf teilweise 80 Prozent gehoben.
- Mehrweg bei Konzert-Veranstaltungen: Zusammen mit unterschiedlichen Partner:innen ließ sich beweisen, dass Mehrweg selbst auf Großveranstaltungen machbar ist. Das Publikum von drei Konzerten der Band „Die Ärzte“ wurde im August 2024 komplett mit Mehrweg versorgt, wodurch sich Unmengen an Verpackungsmüll einsparen ließen.
Mehr Informationen zu diesem Thema:

6 - Klimaschutz
Klimaschutz in Zeiten der Rekorde
2023 und 2024 waren Jahre unrühmlicher Rekorde. Wieder einmal! 2023 machte Schlagzeilen als das global wärmste Jahr seit Beobachtungsbeginn 1880, womöglich sogar seit 100.000 Jahren, so der EU-Klimadienst Copernicus. Im Jahr darauf wurde die neue Spitze schon zur Makulatur. Bereits im Oktober wurde 2024 zum neuen Hitzerekordjahr erklärt. Aber trotz Alarmstufe Rot bleibt jede Klimakonferenz ein Kraftakt mit ungewissem Ausgang. Das weiß der WWF aus eigener Erfahrung. Als entschlossener zivilgesellschaftlicher Akteur begleitet er diese Großveranstaltungen mit einer entschieden rationalen Agenda: wirksamer Klimaschutz überall und in allen gesellschaftlichen Sektoren – jetzt! Auch in Deutschland.

- Die „Dirty Dozen“ der Chemieparks in Deutschland: Nach der aufsehenerregenden Untersuchung der 30 schmutzigsten Industrieanlagen Deutschlands, legten WWF und Öko-Institut nach und untersuchten im März 2024 die zwölf schmutzigsten Chemieparks Deutschlands, die „Dirty Dozen“. Ergebnis dieser neuen Analyse: Die zwölf Schwergewichte der deutschen Chemieindustrie verantworteten 2022 rund 23 Millionen Tonnen CO2. Das sind drei Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands.
- Sanierungen zahlen sich langfristig aus: Und noch eine Veröffentlichung unserer Energie- und Klimaexpert:innen sorgte 2024 für Aufmerksamkeit: die WWF-Arbeit „Auf die Zukunft bauen – So rechnen sich Sanierungen“. Die Fragestellung: Lohnt sich die Sanierung samt Heizungstausch eines Ein- oder Mehrfamilienhauses beispielsweise? Ergebnis: Gerade bei Einfamilienhäusern lassen sich durch Sanierungen und Heizungstausch langfristig tausende Euro einsparen. Auch wenn noch Hindernisse beiseite geräumt werden müssen, lohnen energetische Gebäudesanierungen: Sie sind eine Investition in die Zukunft, bringen den Klimaschutz voran, steigern den Immobilienwert und machen die Bewohner:innen unabhängiger von Energiepreisen.
- Langfristige Klimaschutzfinanzierung: Engagiert und lautstark mischte sich der WWF in die Haushaltspolitik des Bundes ein. Anlass war das Urteil des Verfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds im November 2023. Diese Entscheidung löste eine Haushaltskrise aus, von der sich die Regierung nicht erholte. Die Folge des Gerichtsentscheids waren massive Kürzungen, unter denen Klima- und Biodiversität zu leiden hatten. Uns hingegen, dem WWF, lag und liegt daran, dass die Klimaschutzfinanzierung langfristig auf sicheren Beinen steht. Unsere Forderungen haben wir über Social Media und in Medienstunts nach außen getragen. Zusammen mit gewichtigen Akteuren aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft haben wir einen offenen Brief veröffentlicht, Forderungspapiere verfasst, Pressearbeit betrieben, Vorträge gehalten ... und: Unser Engagement geht weiter
„Wir zeigen: Energetische Gebäudesanierungen zahlen sich aus! Nur durch Klimaschutz in allen Sektoren können wir es schaffen, langfristig zu profitieren und eine lebenswerte Zukunft zu erhalten. Dazu zählt eben auch der Gebäudesektor.“
Sebastian Breer, WWF-Policy Advisor Climate and Energy
Mehr Informationen zu diesem Thema:

7 - Menschenrechte
Laut Amnesty International waren während unseres Berichtszeitraums 2023/2024 „Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte weltweit so bedroht wie seit Jahrzehnten nicht mehr“. Der WWF führt viele seiner Projekte in den menschenrechtlich heikelsten Regionen der Welt durch. Vielen gemein sind die schwachen rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen, unter denen wir dort unsere Projekte realisieren, die Restriktionen, denen sich zivilgesellschaftliche Organisationen und Engagements in vielen Ländern gegenübersehen, und das weltweit hohe Risiko, dem sich Aktivistinnen und Aktivisten beim Schutz von Umwelt und Menschenrechten aussetzen.

- Wir bleiben am Ball: Wir stehen kontinuierlich im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in der kriegsversehrten Ukraine, in konfliktbetroffenen Ländern wie Myanmar oder der Demokratischen Republik Kongo (DRC), um nur einige zu nennen. Ihre Situation macht uns betroffen und motiviert uns. Der WWF bleibt unbeirrt in seiner Entschlossenheit, diese wachsende Herausforderung anzunehmen. Inspiriert durch die Guiding Principles der UN verbessern wir kontinuierlich unsere Strukturen und erweitern unser Wissen, um die Rechte von Menschen zu schützen, die durch unsere Arbeit berührt werden.
- Menschenrechtliche Sorgfalt: „Do no harm“: In einer Grundsatzerklärung hat sich der WWF Deutschland 2019 zur menschenrechtlichen Sorgfalt verpflichtet. Seitdem haben wir eine Vielzahl strukturierter Maßnahmen ergriffen, um das Risiko von Menschenrechtsverletzungen bei der Ausübung unserer Arbeit zu reduzieren und Menschenrechte aktiv zu fördern. 2019 hat das WWF-Netzwerk das vorläufige Environmental and Social Safeguards Framework(ESSF) eingeführt, zum Management, zur Abwendung und Verminderung unbeabsichtigter sozialer und ökologischer Risiken in unseren Projekten. Das ESSF wurde 2021 öffentlich konsultiert. Der WWF Deutschland hat diesen Prozess maßgeblich mitgestaltet, der Mitte 2023 mit Verabschiedung des ESSF durch alle Gremien des WWF-Netzwerks abgeschlossen wurde. Damit verfügt der WWF über ein konsistentes, final verbindliches Instrument, mit dem sich menschenrechtliche Sorgfalt zusammen mit seinen Partnern vor Ort umsetzen lässt.
- Starker Partner in einem starken Netzwerk: Voraussetzung für die Stärkung von Menschenrechten im Naturschutz und in der Transformation ist eine inklusive konfliktsensible Haltung. Im Verständnis des WWF-Netzwerks besteht inklusiver Naturschutz aus einer Vielzahl von Ansätzen, die verschiedene Werte und Visionen zum Schutz der Natur berücksichtigen und gleichzeitig Vorteile für Mensch und Natur bieten. Der WWF bemüht sich um ein ganzheitliches Verständnis der Kontexte, die wir in unserer Arbeit berühren, und die Dynamik zwischen Akteurinnen und Akteuren sowie Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern. Im Mai 2024 hat das WWF-Netzwerk das Environmental Human Rights Defenders Support Tool gelauncht und im folgenden Juni die Inclusive Conservation Guidance verabschiedet. In Letztere sind die Erfahrungen einer Vielzahl von WWF-Büros weltweit eingeflossen. Der WWF Deutschland unterstützt die WWF-Netzwerkprozesse zu inklusivem Naturschutz, zu Konfliktsensibilität und zum Schutz von Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten mit Personal und Ressourcen. Damit dem Thema Konfliktsensibilität innerhalb unseres Netzwerks mehr Aufmerksamkeit zuteil wird, haben es sich der WWF Deutschland, der WWF Kolumbien, der WWF DRC (Democratic Republic of Congo) und der WWF Myanmar in einer Partnerschaft zur Aufgabe gemacht, Konfliktsensibilität in allen Bereichen der Organisation zu verankern. Unterstützt wird die Partnerschaft von PeaceNexus, einer unabhängigen Schweizer Stiftung, die auf die Themen Konfliktsensibilität und Friedensförderung spezialisiert ist. Im Rahmen dieses Projekts hat der WWF Deutschland auch an der dritten „International Conference on Environmental Peacebuilding“ im Juni 2024 in Den Haag teilgenommen. Die erste Projektphase endete im März 2024. Die zweite Phase läuft seit April 2024 bis März 2025.
- Herausforderungen im Berichtsjahr 2023/2024: Der WWF Deutschland hat sich in den Berichtsjahren 2022/2023 und 2023/2024 neu strukturiert. Dies hatte Folgen für interne Prozesse, auch im Bereich der menschenrechtlichen Sorgfalt. Einige Vorhaben mussten vorübergehend ausgesetzt werden, z. B. die Integration von menschenrechtsbasierten Ansätzen in interne Prozesse. Während der Umstrukturierungen war die Position des Human-Rights-Due-Diligence-Managers bzw. der -Managerin vakant. Dadurch konnte entgegen der Planung noch kein Beschwerdemechanismus im Sinne der menschenrechtlichen Sorgfalt für den WWF Deutschland aufgebaut werden. Zwar finden Beschwerdefälle in den internationalen Projektgebieten kraft der Prozesse und Mechanismen des WWF-Netzwerks weiter Gehör und es wird ihnen nachgegangen. Allerdings sind einer transparenten Berichterstattung sowie einem organisationsweiten Lernen derzeit Grenzen gesetzt. Zudem hat sich ein Beschwerdemechanismus in den Projektgebieten in Deutschland noch nicht etablieren können. Die damit verbundenen Risiken sind erkannt. Die Position der Human-Rights-Stabsstelle ist durch die strategische Neuausrichtung des WWF Deutschland verstärkt hervorgegangen und wurde zum Finanzjahr 2024/2025 neu besetzt. Die Einführung eines Beschwerdemechanismus hat jetzt größte Priorität. Der WWF Deutschland steht hier in ständiger Verhandlung mit seinen Partnern. Noch haben wir dafür keine dauerhafte Lösung gefunden. Der WWF Deutschland ist fest entschlossen, als Organisation weiter zu lernen.
„Am Ende geht es nicht um Prozesse oder Regulierungen, sondern darum, ‚Mensch‘ zu bleiben; hinzusehen und zu handeln, wenn Rechte verletzt werden, die universell gelten, ob am Amazonas oder an der Ostsee.“
Katharina Lang, WWF-Referentin Human Rights
Mehr Informationen zu diesem Thema:

8 - Nachhaltige Lebensmittelproduktion
Früchte des Wandels
Seit mehr als 60 Jahren setzt der WWF alles daran, die Natur zu bewahren und die Symptome eines überlasteten Planeten zu lindern. Inzwischen setzen wir auch verstärkt bei den Ursachen an: Denn es führt kein Weg daran vorbei, unseren Lebens- und Konsumstil so zu verändern, dass planetare Belastungsgrenzen eingehalten werden. Dafür steht der Begriff „Nachhaltigkeits-Transformation“. Dazu zählt auch die Art und Weise, wie Unternehmen wirtschaften und ihre Produkte und Lieferketten transformieren.

So arbeiten die Naturschützer:innen des WWF mit dem EDEKA-Verbund in zwei Feldprojekten zusammen, um den konventionellen Anbau von Zitrusfrüchten, auch den von Bananen, nachhaltiger zu gestalten. Denn insbesondere der konventionelle Anbau, der immer noch mit Abstand am weitesten verbreitet ist, muss dringend verbessert werden.
Saftig-süße Orangen, Mandarinen und Clementinen sind besonders im Winter beliebt, wenn heimisches Obst rar ist. Das Pojekt „Für bessere Orangen, Mandarinen und Clementinen“ ist in Spanien beheimatet und setzt auf vier Grundpfeiler: Neben dem sparsamen Umgang mit Wasser und einem verantwortungsvolleren Umgang mit Böden geht es dabei auch um den verringerten Einsatz von Pestiziden sowie um den Schutz biologischer Vielfalt und von Ökosystemen. An dem 2015 in der Region Sevilla gestarteten Projekt nehmen in zwischen 27 Betriebe teil, die die Maßnahmen auf einer Fläche so groß wie die Ostseeinsel Hiddensee umsetzen. Die Früchte der Projektfarmen landen bereits in den Regalen von EDEKA und Netto Marken-Discount. Mittlerweile stammt jede sechste dort verkaufte konventionelle Orange aus dem Zitrusprojekt.
Es gibt immer wieder Gelegenheit, Erfolge zu feiern:
- 2023 ist es beispielsweise durch die Installation von Feuchtigkeitssonden und eine optimierte Bewässerungsplanung gelungen, den Wasserverbrauch um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verringern.
- Indem Pestizide gezielter angewendet und besonders toxische Mittel ausgeschlossen werden, konnten die Farmer:innen die Menge der verwendeten Pflanzenschutzmittel deutlich verringern. Übrigens: Eingesetzt werden Pestizide nur, wenn es wirklich nötig ist, und nicht präventiv. Mehr Hecken, begrünte Wasserstaubecken und vielfältige Pflanzendecken sorgen für die Ausbreitung von Nützlingen, wie etwa dem Marienkäfer.
- Ganze 88 Hektar des Anbaugebiets sind als Blüh- und Schutzflächen angelegt. Das entspricht der doppelten Fläche des Botanischen Gartens Berlin. Auch der Bruterfolg der Vögel ist erfreulich. Denn Vögel unterstützen die biologische Schädlingskontrolle im Feld.
„Zusammen mit EDEKA schaffen wir es, den konventionellen Anbau von Zitrusfrüchten deutlich nachhaltiger zu gestalten. Wir brauchen den Einsatz vieler weiterer Unternehmen, die sich für diese Art des Anbaus auf noch größerer Fläche einsetzen.“
Patrick Freund, WWF-Project Manager Sustainable Supply Chain
Mehr Informationen zu diesem Thema:

9 - One Planet Business
Ein großer Wurf
Mit seiner strategischen Revision hat sich der WWF weiterentwickelt. Seinem Auftrag, Bewahrer der Natur zu sein, hat er ein weiteres Wirkungsfeld zur Seite gestellt: das des Mitgestalters wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Transformation. Dieser Arbeitsbereich hat massiv an Bedeutung gewonnen. Er begleitet transformationsbereite Wirtschaftsunternehmen auf ihrem Weg zum One Planet Business. Dahinter steht die Erkenntnis, dass die Erde Grenzen hat: Belastungsgrenzen und solche der Ressourcenverfügbarkeit. One Planet Economy nennt sich das Wirtschaften, das diese Grenzen berücksichtigt. 2024 hat der WWF dazu ein Rahmenwerk veröffentlicht, das One Planet Business Framework, kurz OPBF. Entstanden ist ein richtig großer Wurf.

Wer den WWF bisher als Umweltorganisation im Kopf hatte, muss weiterdenken und sollte ihn ab sofort auch als Begleiter der Nachhaltigkeits-Transformation der Wirtschaft abspeichern. Zu dieser Einschätzung kam auch der Deutschlandfunk nach Lektüre dieser WWF-Veröffentlichung. Eine Reaktion aus Überraschung und Interesse, die in einigen Medienbeiträgen zum Ausdruck gekommen ist. Mit dem OPBF ist es dem WWF erneut gelungen, sich von einer vielen noch immer unbekannten Seite zu zeigen: als Wissensvermittler, Berater und Brückenbauer für Nachhaltigkeits-Transformation. Adressaten dieses Rahmenwerks sind Unternehmen, die wissen wollen, was auf dem Weg zur Nachhaltigkeit getan werden muss, wie sie regulatorischen Entwicklungen vorgreifen und ihre Zukunftsfähigkeit sichern können.
Das OPBF richtet sich vor allem an Großunternehmen und größere Mittelständler, bietet jedoch Anreize auch für kleinere Betriebe. Ihnen allen hilft das OPBF bei der Beantwortung dreier Fragen:
- Was müssen Unternehmen beachten, um die relevanten Nachhaltigkeitsbausteine innerhalb der OPBF-Dachthemen Klima, Biodiversität, Süßwasser und Menschenrechte in ihre Unternehmenspraxis zu integrieren?
- Welche Ziele sollten sich Unternehmen setzen, um ihr Handeln an den Belastungsgrenzen des Planeten auszurichten und mit gesellschaftlichen Zielen sowie bewährten unternehmerischen Praktiken in Einklang zu bringen?
- Wie können Unternehmen planvoll vorgehen, damit die Transformation zum Erfolg führt?
„Die Wirtschaft spielt eine doppelte Rolle: Sie trägt sowohl zur ökologischen und sozialen Krise bei als auch zu deren Lösung. Unser Nachhaltigkeitsrahmenwerk bietet Unternehmen praktische Lösungen, die sie in jeder Phase ihres Transformationsprozesses unterstützen.“
Dr. Julia Strahl, WWF-Managerin Sustainable Business & Markets
Mehr Informationen zu diesem Thema:

10 - Nature Restoration Law
Ein Zurück der Natur
Sandkoralle, Luchs, Feldhamster oder Kiebitz – bei allen Unterschieden haben diese Tierarten eins gemeinsam: Sie sind in Deutschland stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Und sie sind nur Beispiele für den fortschreitenden Niedergang unserer Natur. Fast 70 Prozent unserer natürlichen Lebensräume befinden sich in ungünstigem oder schlechtem Zustand. Ähnlich ist das Bild bei unseren europäischen Nachbarn. Entsprechend groß waren die Hoffnungen, als die Europäische Kommission ihren Entwurf für eine Naturwiederherstellungsverordnung (Nature Restoration Law, NRL) vorlegte. Damit sollen bis 2030 mindestens 20 Prozent der europäischen Land- und Meeresflächen renaturiert werden, bis 2050 sogar alle geschädigten Ökosysteme. Niemand konnte ahnen, dass damit ein Politkrimi begann.

- Die Interessenlage: Bis zum Schluss wurde um die Initiative gestritten. Von deutscher Seite drohte kurzzeitig ein Rückzug von der Zustimmung, weil sich die Koalition nicht einig wurde. Erneut sah sich die deutsche Landwirtschaft in Gefahr, obgleich doch eine gesunde Natur Voraussetzung für nachhaltige Erträge ist. Am Ende reichte es im Europaparlament nach Kompromissen von allen Seiten doch, wenn auch knapp, für eine Mehrheit. Im Sommer 2024 kam dann der Durchbruch. Das NRL (Nature Restoration Law) wurde beschlossen.
- Die Beschlusslage: Aber was hat Europa da eigentlich beschlossen? Wie geht das überhaupt, die Natur „wiederherzustellen“? Handeln in diesem Sinne kann auch bedeuten, gar nichts zu tun. Der Natur zu erlauben, dass sie sich ohne schädigende Einflüsse des Menschen einfach erholt. Als Wiederherstellungsmaßnahmen gelten beispielsweise die Wiedervernässung trockengelegter Moore, der Waldumbau hin zu naturnäheren und klimaresilienteren Wäldern.
- Die Erwartungslage: Kommt das NRL ans Ziel, ist nicht nur der Natur gedient, sondern auch uns Menschen. Schließlich haben die Maßnahmen einen positiven Effekt auf Klimaschutz und Klimaanpassung. Aus der Perspektive ökonomischer Rationalität ist eine intakte Natur Produzent und Lieferant unentbehrlicher Ökosystemleistungen. Es heißt, Politik sei das Bohren dicker Bretter. Der WWF hat gebohrt. Gemeinsam mit anderen Umweltorganisationen hat er für die Naturwiederherstellungsverordnung gekämpft. Hierzulande hat der WWF Deutschland erklärt und beworben, was schließlich Gesetz werden sollte. Er diskutierte mit Abgeordneten und sensibilisierte die Presse. Im Bündnis mit den Partnerorganisationen trug er 800.000 Unterschriften zusammen und fand Öffentlichkeit mit einer gemeinschaftlichen Aktion vor dem Bundesumweltministerium.
- Die Finanzlage: Das NRL ist ein großer Erfolg des Naturschutzes. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Zwei Jahre bleiben den EU-Mitgliedsstaaten, um „Nationale Wiederherstellungspläne“ aufzustellen. Darin muss stehen, wo und mit welchen Projekten renaturiert werden soll. Das verlangt viel Koordination zwischen Bund und Ländern und wird nur Erfolg haben, wenn die wichtigen gesellschaftlichen Interessengruppen eingebunden werden. Welche Interessen der WWF dabei vertreten wird, ist klar: die der Natur. Klar ist aber auch: Renaturierung kostet Geld. Nationale Etats zur Finanzierung von Biodiversitätsmaßnahmen müssen deshalb verstetigt werden. Und auch die EU muss sich stärker finanziell engagieren – am besten mit einem eigenständigen EU-Naturschutzfonds.

Der WWF in Zahlen
Strategische Umstrukturierung und Konsolidierung
Der WWF Deutschland steht vor bedeutenden Herausforderungen. Die Biodiversitäts- und Klimakrise drängt zum Handeln. Zugleich werden vielerorts die Mittel für den Schutz von Natur und Klima knapper. Dies gilt für öffentliche Zuwendungen wie auch für die generelle Spendenbereitschaft. So setzen wir alles daran, die begrenzten Ressourcen effektiv und maximal wirkungsvoll zu verwenden. Hierzu hat der WWF Deutschland im Frühjahr 2024 nach vielen Jahren starken Wachstums eine strategische Fokussierung und Konsolidierung beschlossen, die mit einer organisatorischen Neuaufstellung einhergeht. Damit sorgen wir für Stabilität auch in Zukunft, um ebenso stark wie wirksam zu bleiben. Das ist unser Anspruch. Das entspricht zugleich der Erwartungshaltung unserer Spender:innen, Partner:innen, Zuwendungsgeber:innen und Ehrenamtlichen.
Damit konnte der WWF weiter seine Mission vorantreiben, die Natur und Umwelt in vielen Teilen der Erde zu bewahren, die politischen Rahmenbedingungen für deren Schutz zu verbessern und die Transformation der Wirtschaft voranzubringen.
Den kompletten Jahresbericht hier downloaden!
Die WWF-Wissen-App
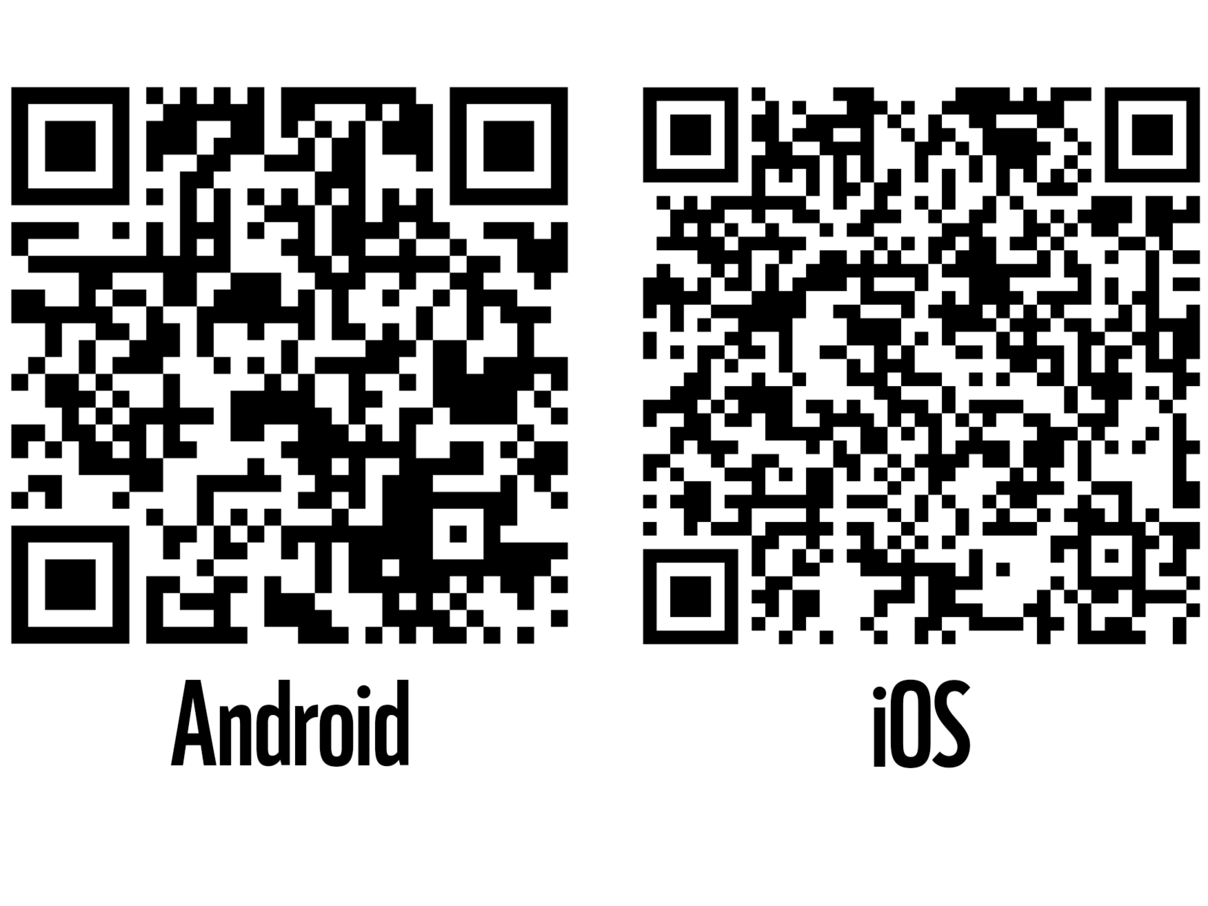
Für alle Smartphone- und Tabletnutzer:innen ist der Jahresbericht auch in der WWF-App „WWF Wissen“ abrufbar.
Die WWF Jahresberichte der letzten Jahre
-
 WWF Jahresbericht 2022/2023
WWF Jahresbericht 2022/2023 -
 WWF Jahresbericht 2021/2022
WWF Jahresbericht 2021/2022 -
 WWF-Jahresbericht 2020/2021 – WWF Deutschland
WWF-Jahresbericht 2020/2021 – WWF Deutschland -
 WWF-Jahresbericht 2019/2020 – WWF Deutschland
WWF-Jahresbericht 2019/2020 – WWF Deutschland -
 WWF-Jahresbericht 2018/2019 – WWF Deutschland
WWF-Jahresbericht 2018/2019 – WWF Deutschland





