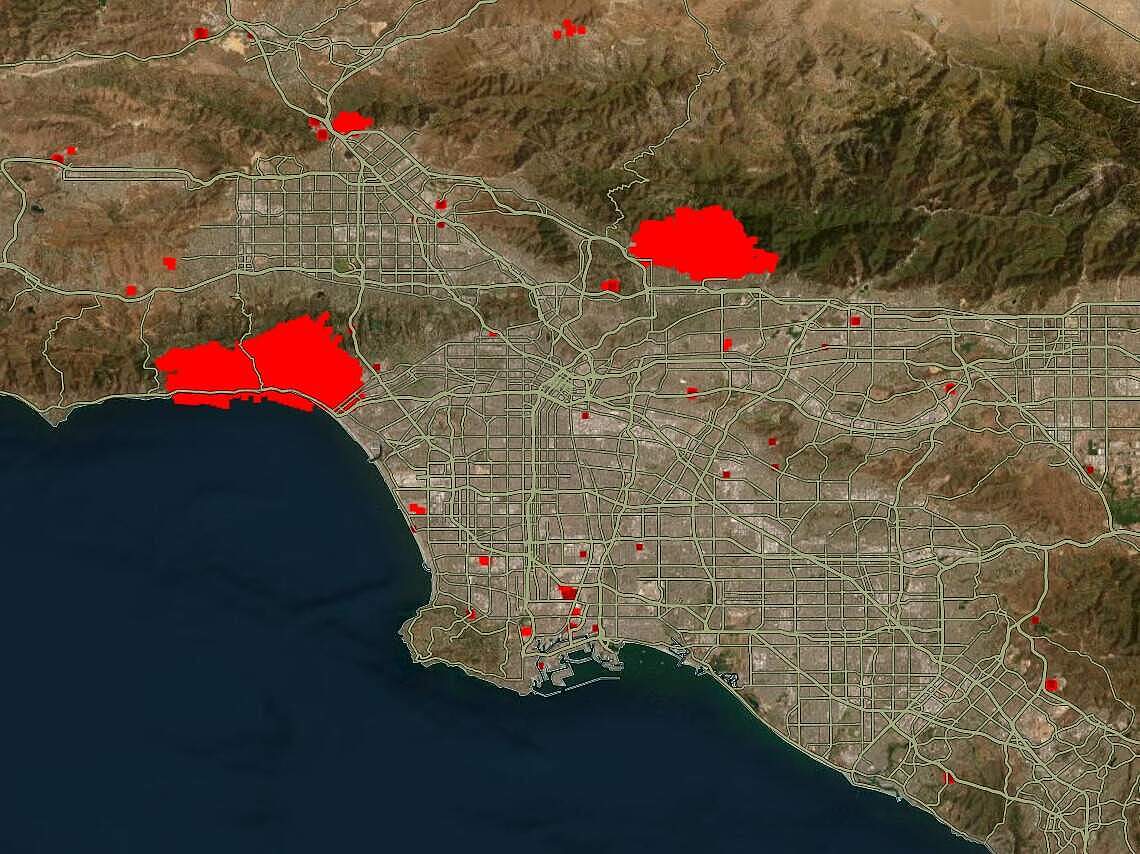In vielen Regionen der Welt waren Brände ein natürliches, zum Teil regelmäßig auftretendes Phänomen, etwa in den Eukalyptuswäldern Australiens, deren Vegetation an Feuer angepasst ist, oder im Grasland der Savannen Afrikas und Südamerikas, das sich rasch erholt. Die Wälder im Westen der USA und Kanadas sind sogar von periodischen Feuern abhängig, um sich verjüngen zu können.
Doch das Brandgeschehen hat sich verändert, so die Bilanz des WWF Feuerkompass: Seit der Jahrtausendwende brennen Feuer immer stärker. Experten sprechen von sogenannten Extremfeuern. Damit gemeint sind sehr große, enorm heiße und sich rasend schnell ausbreitende Feuer, die nur schwer oder gar nicht mehr zu kontrollieren sind. Diese Brände können Feuersäulen entwickeln, die einen Kilometer und mehr in die Höhe steigen. In Kontakt mit kalten Luftschichten reagieren sie explosionsartig und können neue Feuer in bis zu 60 Kilometer Entfernung entfachen.